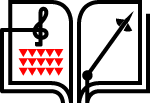Schalmei
Die nach ihrem Erfinder Max B. Martin benannte Martinstrompete entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als Signalinstrument und wird als eigenständiges Musikinstrument auch Schalmei genannt. Mit der Schalmei als historischem Doppelrohrblattinstrument ist das Einfachrohrblattinstrument instrumentenkundlich nicht verwandt, nur der durchdringende Klang hat gewisse Ähnlichkeiten.
Entstehung
Am 16.08.1927 erteilte das Reichspatentamt Max Bernhard Martin in Markneukirchen das Patent für ein „Blasinstrument mit einer Anzahl selbstständiger mit Zungenstimmen versehener Tonerzeuger“.
Das Konstruktionsprinzip der Martintrompeten ist relativ einfach: Mehrere Eintoninstrumente mit aufschlagenden Zungen werden in ein Instrument zusammengefasst. Die einzelnen Tonröhren lassen sich mittels mehrerer (Périnet-)Ventile wahlweise ein- und ausschalten. Instrumentenkundlich gesehen handelt es sich mithin um ein Aufschlaginstrument.
Einton-Signalinstrumente waren schon länger in Gebrauch, z.B. bei Türmern, Jägern und Wildhütern, sowie in der Industrie. Nach 1900 kamen die Automobilisten dazu. Hier begann es mit der Hand betätigten Einzelhupe (Ballhupe), doch bestand Bedarf nach einem Gerät, mit dem gleichzeitig mehr als ein Ton und damit ein gewisser Wohlklang produziert werden konnte.
Dem entsprach ein am 24.12.1911 patentiertes Instrument von M. B. Martin.
Dieses mehrtönige Muster (Akkordinstrument), ausgestattet mit Ventilen, gab Max B. Martin an den damaligen Kaiser Wilhelm II. und erhoffte sich eine Verkaufsgrundlage. Es kam jedoch anders. Der Monarch verlangte es für sich, da blieb das Geschäft aus. In seinem Automobil fuhr ein Trompeter mit, der auf der „silbernen Kaiserfanfare“ das Heranfahren des Herrschers bei besonderen Anlässen ankündigen musste.
Bemerkenswert ist, dass das 1911 patentierte Instrument von der Funktion und der Konstruktion her exakt jenem entspricht, das 1927 patentiert wurde und von da sich rasch durchsetzte. Der Unterschied lag einzig darin, dass das spätere Modell zum Spiel von Einzeltönen (Melodiespiel) gedacht war. Es wurden von Beginn der Serienfertigung an beide Typen nebeneinander gebaut und für die voll besetzten Schalmeienkapellen noch heute benutzt.
Das war auch die Zeit, in der viele so genannte Martin-Kapellen gegründet wurden. Auch die 8-tönigen Martin-Trompeten, auch Schalmei genannt, hat Max Martin erfunden. Seit den 80er Jahren erweitern 16-tönige Martin-Trompeten das Lieferprogramm. Heute werden davon nur noch einige wenige verkauft, sie sind aber weiter im Sortiment. Der Hersteller, 1880 gegründet als Deutsche Signal-Instrumentenfabrik Max B. Martin GmbH & Co. KG in Markneukirchen/Sachsen, fertigte damals Rufhörner, Jagdhörner, Kavallerie-Trompeten und Fanfaren-Trompeten.
"Nach dem zweiten Weltkrieg sollte der Betrieb in der damaligen DDR in einen Volkseigenen Betrieb umgewandelt werden, das Unternehmen zog daraufhin zuerst nach Bayreuth und dann nach Philippsburg, einige der wenigen Städte, die in der Nachkriegszeit schon wieder mit Gas versorgt waren. Am heutigen Standort dort, residiert man seit 1961", berichtet Martin Brender, dessen Ehefrau die Urenkelin des Unternehmensgründers ist.[1] Auch heute stellt die Firma Signalhörner und Instrumente mit dem traditionellen Klang her.
In der DDR wurde der ursprüngliche Betrieb von Max Martin zur VEB Blechblas- und Signal-Fabrik in Markneukirchen. Nach dem Zerfall der DDR entstanden mehrere Firmen von Instrumentenbauern, die ebenfalls weiterhin die Schalmei produzieren.
Tonerzeugung
Der Ton wird mit einer aufschlagenden Zunge durch Atemluftdruck des Bläsers erzeugt, eine Resonanzröhre mit angedeutetem Schallbecher dient unterstützend zur Erzeugung eines höhenmäßig definierten Tones, der auch dynamisch nicht verändert werden kann. Mitunter wird als Mundstück das einer Trompete verwendet, was physisch nicht notwendig ist, da die Lippen des Bläsers nicht wie bei Blechblasinstrumenten schwingen dürfen. Ebenso kann die Luft durch ein flaches, ovales, in den Mund genommenes Rohr geblasen werden.
Unterscheidung
Signalinstrumente
Im einfachsten Fall hat das Rufhorn („Hupe“) nur einen Ton und benötigt damit, im Gegensatz zum mundangeblasenen zweitönigen Folgetonhorn, kein Umschaltventil. Da beide vordergründig als Signalhorn verwendet werden, gibt es auch Rufhörner mit zwei Tönen, die jedoch nur wenige Cent nebeneinanderliegend auf „Schwebung“ (auch Tremolo genannt) gestimmt sind und dadurch einen noch lauteren Höreindruck vermitteln.
In der frühen Zeit der „Automobilisten“ nach 1900 wurde die Ballhupe mit aufschlagender Tonzunge eingesetzt. Die Martin-Trompete als Vorgänger des automatischen Folgetonhorns wurde als sogenannte „Kaiserfanfare“ berühmt, deren Signal „bald hier, bald dort“ ein Fahrzeug der kaiserlichen Familie ankündigte. Heute ist es als Martinshorn der Feuerwehr bekannt.
Musikinstrument

Martinstrompeten als Musikinstrumente entstanden ab 1905 und bestehen aus fünf bis sechzehn gebündelten Einzelhupen, die durch ein Ventilsystem jeweils eine oder drei Schallröhren mit der festgelegten Tonhöhe auswählen. Da das Instrument robust konstruiert ist, keine besondere Anblastechnik benötigt und nur geringe Notenkenntnisse voraussetzt, ist es ideal geeignet, auch von Anfängern erlernt und gespielt zu werden.
Man unterscheidet zudem zwischen den 8-tönigen, diatonischen Schalmeien (nur ganze Töne) und den 16-tönigen chromatischen Schalmeieninstrumenten (ganze Töne und halbe Töne). Es gibt Instrumente, die nur Einzeltöne für Melodie und Nebenstimmen spielen können, und es gibt Begleitinstrumente, die zwischen zwei oder vier mehrtönigen Begleitakkorden wechseln können.
Die Firma Max B. Martin in Markneukirchen als ursprünglicher Hersteller wurde nach der Deutschen Teilung 1950 für kurze Zeit treuhänderisch weitergeführt und zum VEB Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen,1953 zum Werk I des VEB B & S (Blechblas- und Signalinstrumentenfabrik Markneukirchen). In der DDR wurden die Instrumente unter dem Markennamen „Weltklang“ hergestellt, Später als „B&S“. Eine damalige (genaue Datierung nicht möglich) Broschüre mit Preisen ist per Klick hier aufrufbar (PDF).
Gerhard A. Meinl brachte 1991 sein elterliches Unternehmen, die Wenzel Meinl GmbH (WMM) in Geretsried, als Hersteller der Melton-Blechblasinstrumente in die TA Triumph-Adler AG ein und begann, die IMM Musik Gruppe und später die TA Musik Gruppe aufzubauen und zu leiten. Er erwarb die ehemalige VEB Blechblas- und Signalinstrumentenfabrik und wandelte diese zur Vogtländischen Musikinstrumentenfabrik (VMI) um. Heute gehört das Unternehmen als Buffet Crampon Deutschland GmbH als Tochter zur Buffet Crampon S.A.S. in Frankreich. Die Marke „B&S“ ist weiterhin in Verwendung für Blechblasinstrumente, eine Herstellung von Schalmeien erfolgt jedoch längst nicht mehr.
Eine Kapelle hatte in der Regel folgende Bestzung mit entsprechend gebauten Schalmeien:
Sopran-Schalmei
Dieses Instrument übernimmt die Funktion der ersten Stimme. Die Sopran-Schalmei gibt es in liegender und stehender Form, wobei die stehende Version verbreiteter ist. Eine Sopran-Schalmei hat den Tonumfang von g‘ bis g“.
Bariton-Schalmei
Ursprünglich gab es dieses Instrument in gerader Form. Durch das enorme Gewicht, es ist ja immerhin doch über einen Meter lang, wird es nur noch in stehender Form gebaut. Bevor die Tenor – Schalmei auf den Markt kam, wurde das Bariton als zweite Füllstimme benutzt. In den neueren Liedern findet man immer mehr das Bariton als rhythmisches Begleitinstrument. Der Tonumfang entspricht dem des Soprans, nur eine Oktave tiefer. Der Tonumfang ist g bis g‘ also eine Oktave tiefer wie das die Sopran-Schalmei.
Alt-Schalmei
Hier findet sich die zweite Stimme der Kapelle wieder. Ebenso wie das Sopran-Instrument, werden hier zwei Formen angeboten, wobei wiederum die gerade wesentlich öfter in Gebrauch ist.
Accord-Schalmei
Für Begleitzwecke und zur „Füllung“ des Klangkörpers gibt es mehrtönig klingende Instrumente (so genannte Akkord-Schalmeien), bei denen mehrere Töne (Akkorde) gleichzeitig erklingen.Vergleichen kann man das Instrument mit dem Akkordspiel der Gitarre. Durch Drücken mehrerer Seiten und überstreichen zur gleichen Zeit, läst man einen sogenannten Akkord erklingen.Bei der Akkordschalmei erzeugen wir mit einem Tastendruck das Erklingen von 3Tönen zur gleichen Zeit. Einen Dreiklang. Und erreichen damit den gleichen Effekt wie auf der Gitarre.Allerdings ist bei der Akkord Schalmei der Tonumfang begrenzt.Beim 4 fach Akkord auf 4 Akkorde zur F- Dur.Beim 8 fach Akkord auf 8 Akkorde zur F-Dur. Hier sind die Mollakkorde mit enthalten.Beide Instrumente werden in unserer Schalmeienkapelle benutzt. Das Accordinstrument ist eines der größten und schwersten Instrumente.
Bass-Schalmei
Die 4 tönige Bass-Schalmei ist nur wenig verbreitet. Es gibt sie in 2 unterschiedlichen Formen: Aufrecht stehend als Tuba Bassform und als Rundbass, auch unter dem Namen Helikonbass bekannt, den man umhängen kann.Sie haben beide nur vier Schallbecher (also 4 Töne) und daher nur zwei Ventile. Die Töne sind: G, H, c, d
Pflege
Originaltext eines Handzettel der VEB Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik von 1952 (516 III/23/6 B 23 60 10,0):
Behandlungsvorschrift für Martin-Trompeten (Schalmeien)
Die Erfahrungen haben gelehrt, daß der Behandlung der Martin-Trompeten (Schalmeien) nicht die Sorgfalt gewidmet wird, die jedes Musikinstrument verlangt. Dadurch leidet die Stimmung der Instrumente, die Musik klingt nicht mehr einwandfrei und für die Beseitigung der Fehler und Beschädigungen, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, müssen unnötig Material und Arbeitszeit aufgewendet werden. Jeder Spieler einer Schalmeie möge sich immer vor Augen halten, daß er ein Musikinstrument in den Händen hat, das einer pfleglichen Behandlung bedarf, wenn es ihm Freude machen soll. Die Leiter der Kapellen müssen, wenn sie einen guten Klangkörper schaffen wollen, in den Proben immer wieder darauf hinweisen.
Es empfiehlt sich, in jeder Kapelle einen geeigneten Kollegen zum Auswechseln von Ersatzteilen usw. an sämtlichen Instrumenten zu beauftragen und den einzelnen Spielern keinesfalls zu erlauben, daß sie die Schalmeien auseinanderschrauben. Bei dem Auseinandernehmen der Instrumente durch unsachgemäße Hände werden fast immer die Stimmen beschädigt. Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten:
Die Zunge muß jeden Ton anstoßen. Also nicht in das Mundstück hineinhauchen oder drücken. Der durch den Zungenstoß hervorgerufene Luftstrom muß den Ton gleichmäßig in der Höhe halten. Läßt die Luft sofort oder auch langsam nach, entsteht ein Mißton, der beizeiten die Stimmenzunge schädigt. Die Stärke des Luftstromes nach dem Zungenstoß darf deshalb niemals nachlassen.
Die Ventile werden von unten herauf, also von den Schallbecheröffnungen aus, gezählt bzw. bezeichnet und mit der rechten Hand wie folgt gegriffen:
- Ventil mit dem Ringfinger,
- Ventil mit dem Mittelfinger,
- Ventil mit dem Zeigefinger.
Die Finger liegen zum Gebrauch immer leicht auf den Ventilen und drücken dieselben erst dann nieder, wenn die Note es verlangt. Das oder die betreffenden Ventile, die den Ton bringen sollen, müssen immer ganz niedergedrückt sein, ehe der Ton von der Zunge gestoßen wird. Befolgt der Bläser diese Vorschrift nicht, kommt der Ton garnicht oder als Mißton, und die Stimmenzunge leidet dadurch.
Beim Blasen hält die linke Hand das Instrument unmittelbar unterhalb der Ventile. Keinesfalls an den Schallbechern halten, weil dadurch der Ton in Klangfarbe und Stimmung beeinträchtigt wird.
Wie bei jedem Ventilblasinstrument muß auch bei den Schalmeien darauf geachtet werden, daß sie nach dem Gebrauch gut von dem angesammelten Speichel gereinigt werden. Dazu wird das Instrument unter abwechselndem Drücken der Ventile mehrere Male nach dem Mundstück zu ausgeschleudert. Soweit sich an den Instrumenten (aufrechte Instrumente und Kontrabässe) Wasserklappen befinden, sind diese regelmäßig zu öffnen und dadurch der angesammelte Speichel abzulassen. Bei gutem Zungenansatz kann jedoch nur sehr wenig Speichel in das Instrument kommen.
Ab und zu müssen die Ventilbüchsen, deren oberer Deckel leicht abschraubbar ist, gut und trocken ausgewischt werden. Dabei sind auch gleich die Wechsel (Ventile) und Ventilfedern gut abzuwischen. Die Ventile dürfen nicht geölt werden.
Beim Versagen einer Stimme genügt meist schon ein Durchblasen des betreffenden Schallbechers von der Ausmündung aus, wobei natürlich die entsprechenden Ventile gedrückt werden müssen, um dem Luftstrom einen freien Weg durch das Mundstück zu schaffen. Dadurch werden Fremdkörper, die sich unter die Stimmenzunge gesetzt haben, beseitigt, wenn sie nicht gerade festgeklebt sind. Spricht der Ton jedoch noch immer nicht sauber an, kann der betreffende Schallbecher nach Lösen der Becherschraube herausgenommen werden. Angesammelte Staubfasern werden dadurch entfernt, daß ein Streifen dünnes, aber festes Papier unter der Stimmenzunge hindurchgeführt wird. (Kein Messer dazu benutzen!) Die Stimmen können auch in heißem Sodawasser ausgewaschen werden.
Die Stimme darf beim Herausnehmen, Durchblasen, Auswechseln und Wiedereinsetzen des Schallbechers in die dafür bestimmte Brummerzwinge nicht verletzt werden. Auf keinen Fall die Stimmenzunge anfassen oder drücken! Nach Wiedereinsetzen des Schallbechers muß darauf geachtet werden, daß das Becherschräubchen gleich wieder eingesetzt wird.
Schalmeienkapellen
Ab 1920 begannen viele Turn- und Radfahrvereine sowie Freiwillige Feuerwehren sogenannte Martin-Kapellen zu gründen. Auch in der Arbeiterbewegung spielte die Martinstrompete als „Schalmei“ eine besondere Rolle. In den Bergmannsrevieren und Industrieballungsgebieten Deutschlands gründeten sich nach dem Ersten Weltkrieg Arbeitermusikvereine, die als „Schalmeienkapellen“ bei Demonstrationen und Kundgebungen der Arbeiterbewegung Arbeiterlieder spielten. Beim Roten Frontkämpferbund spielten die Schalmeien-Kapellen eine zentrale Rolle. Auch Erich Honecker spielte in seiner Jugend beim Roten Frontkämpferbund Schalmei – 1987 schenkte er dem westdeutschen Rockmusiker Udo Lindenberg ein Instrument als Reaktion auf dessen Geschenk einer Lederjacke. Einzig Horst Wessel durchbrach mit einer Ausnahmegenehmigung seines Förderers Joseph Goebbels das linke Monopol und erstellte eine nationalsozialistische Schalmeien-Kapelle. Viele dieser Schalmeienkapellen wurden 1933 nach der Machtergreifung Hitlers aufgelöst, bildeten sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wieder neu.
Heute bestehen deutschlandweit viele Schalmeienkapellen, die sich in örtlichen Vereinen organisieren und öffentlich auf Festen und zu Umzügen (u. a. bei Fastnachtsveranstaltungen) musizieren. Begleitet werden die Schalmeien üblicherweise von diversen Schlaginstrumenten, teils auch Querpfeifen.
In der ehemaligen DDR wurden die Kapellen wie auch die Spielmanns- und Fanfarenzüge möglichst vereinheitlicht und organisiert. Die Besetzung war vorgegeben, Instrumente wurden zentral beschafft. Große Trommel, Marschtrommel, Marschbecken und Lyra entsprach denen der Spielmannszüge. Kleidung je nach Organisation (FDJ, DTSB). Die im Sport organisierten Kapellen hatten ebenso ihre Wettkämpfe und Leistungsvergleiche bis hin zur DDR-Meisterschaft.
Nach der Deutschen Wiedervereinigung waren insbesondere die Schalmeienkapellen sehr schnell damit, diese Vereinheitlichung abzulegen. Statt Marschmusik im Gleichschritt wurde zu Stimmungsmusik gewechselt. Vereinzelt wurden aber Pflicht-Märsche zum gemeinsamen Spiel beibehalten und auch Wettkämpfe finden im Rahmen der Landesmeisterschaften teilweise noch statt.